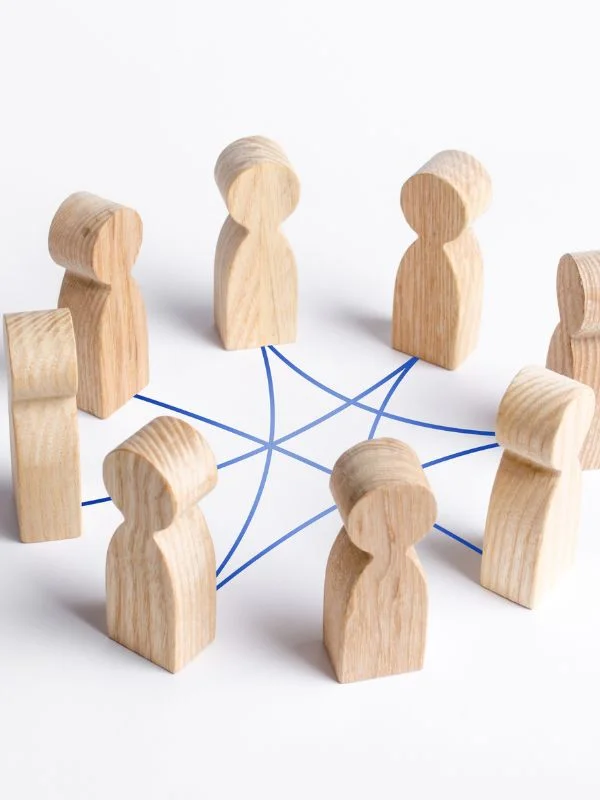Jeder reagiert auf ungewohnte Situationen anders. Manche fangen an, Hamsterkäufe zu tätigen und Dinge in einer Menge einzukaufen, die rational betrachtet, keinen Sinn ergibt. Aber der Mensch reagiert eben nicht rational. In Abhängigkeit von früheren Erfahrungen, Erlebnissen und daraus resultierenden Emotionen ergeben sich Verhaltensweisen, die manchmal absolut unverständlich erscheinen.
„Wir sollten begreifen, dass jeder von uns nur der sein kann, der er aufgrund seiner Anlagen und Erfahrungen sein muss“ (Michael Schmidt-Salomon im Buch „Entspannt euch!“).
Aber wer bin ich und wer bist du? Warum reagieren wir so und nicht anders? Haben wir gelernt, uns zu reflektieren? Eher nicht! Das ist auch nicht schlimm. Jedoch kann es nicht schaden, damit anzufangen. Wenn ich beginne zu überlegen, warum ich etwas tue oder auch nicht tue, dann kann ich zu ganz erstaunlichen Erkenntnissen kommen. Erkenntnisse, die Verständnis schaffen können. Ich glaube, unsere Welt benötigt momentan dringend mehr Verständnis. Verständnis für uns selbst und die Handlungen der Menschen um uns herum.
Dieses kann entstehen, wenn mir klar wird, welche Motive mich und andere antreiben. Welche Motive bedingen welche Handlungsweisen? Also übersetzt: was bewegt uns, bestimmte Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Es gibt ein wunderbares Analyse-Tool (Reiss Motivation Profile®), das die 16 grundlegendsten Lebensmotive eines Menschen aufgreift und erklärbar macht.
Jeder Mensch hat 16 Lebensmotive in seiner ganz speziellen Ausprägung. Diese Ausprägung ist bedingt durch die genetische Veranlagung sowie die kulturellen und individuellen Erfahrungen eines jeden Einzelnen. Das Reiss Motivation Profile® ist somit so einzigartig wie der Fingerabdruck der Person.
Ich finde es zum Beispiel überhaupt nicht schlimm, im Homeoffice und alleine zu arbeiten. Ich bin dabei produktiv und freue mich, wenn die Dinge gut laufen. Es fällt mir sehr leicht, bei Bedarf lange und konzentriert zu arbeiten. Herausforderungen und Probleme führen in der Regel dazu, dass ich mich noch mehr engagiere.

Dies ist durch eine spezielle Ausprägung der Motive Macht und Beziehungen bedingt. Ich kann jedoch nicht davon ausgehen, dass jeder in meinem Unternehmen die gleichen Motive ausleben kann und will. Das ist allerdings auch das Spannende an der Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Jeder ist auf seine Art und Weise richtig! Ich darf mich jedoch für jedes Teammitglied interessieren und versuchen, zu verstehen, welche Motive ausschlaggebend sind. Homeoffice kann für den einen oder anderen eine echte Herausforderung darstellen, wenn die Motive entsprechend ausgeprägt sind.
Das Wissen um diese Motivkombinationen wird dazu führen, dass sie ihre Mitarbeiter entsprechend individuell betreuen können. Steven Reiss sagte:
„Es macht keinen Sinn zu versuchen, eine andere Person zu motivieren, indem man an Werte appelliert, die diese nicht hat.“
Oder anders betrachtet, wenn ich weiß, welche Motive mich antreiben, dann kann ich in meinem Team für Verständnis werben. Ich kann dem Anderen zeigen und sagen: „Ich sehe und verstehe dich. Bitte verstehe mich auch.“
Gemeinsam den richtigen Weg finden
Lass uns gemeinsam herausfinden, welches Coaching oder Training dich wirklich stärkt und in deinem Alltag spürbar weiterbringt
Wie kommen Sie nun an das Wissen über die Motive heran? Sie können im Internet recherchieren, Bücher kaufen oder aber eine Analyse durchführen lassen. Da ich seit längerer Zeit Reiss Motivation Profile® Master bin, kann ich Ihnen dieses gern anbieten. Selbstverständlich können Sie die Analyse auch über einen anderen Master erwerben.
Es handelt sich dabei um einen Fragebogen mit 128 Fragen, der auf der von RMP germany betriebenen Platform als Selbsttest ausgefüllt wird. Die Auswertung erfolgt in einer webbasierten Software, die dem Reiss Motivation Profile® Master die ausgewertete Analyse zum Abruf zur Verfügung stellt. Diese Analyse werde ich (oder ein von ihnen ausgewählter Master) dann mit Ihnen in einem 1- bis 2- stündigen Telefonat oder Zoom-Call besprechen. Danach werden Sie sich selbst und das Verhalten anderer besser verstehen und einordnen können.
Vielleicht ergeben sich daraus sogar die ein oder andere Veränderung in Ihrer Organisationsstruktur. Wenn Sie Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse umfassender verstehen, dann ermöglicht sich auch ein erweiterter Blick auf die Ihrer Mitarbeiter und Ihres Umfeldes mit optimaleren Handlungsmöglichkeiten. Und vielleicht tauschen Sie sich mit Ihren Mitarbeitern aus, die auch ein Profil erstellen lassen. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!